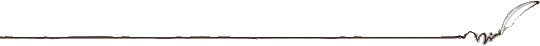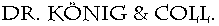
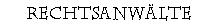
Fast immer beim Erwerb eines Computerprogramms nötigt der Verkäufer den Erwerber zum Abschluß eines sogenannten "Lizenzvertrages". Gegen Zahlung der "Lizenzgebühr" darf der Anwender dann das Programm benutzen; er erhält eine "Lizenz". Dieser - gesetzlich nicht gesicherte - Sprachgebrauch ist derart weit verbreitet, daß manche meiner Mandanten sogar ausdrücklich den Entwurf eines "Lizenzvertrages" verlangen, ohne indes zu wissen, was dies bedeutet und ob für ihre Zwecke ein derartiger "Lizenzvertrag" überhaupt geeignet ist.
Zum besseren Verständnis empfiehlt es sich, die einschlägigen und "alltäglichen" Verträge und deren Bedeutung kurz zu rekapitulieren. So kennt wohl jeder Leser aus dem täglichen Leben die entgeltlichen Verträge des Kaufs, der Miete (hierzu zählen auch Leasingverträge), der Pacht sowie den Werkvertrags (z.B. bei der Beauftragung eines Handwerkers).
Kaufverträge haben meistens Sachen im Sinne des Gesetzes, also körperliche Gegenstände,
zum Gegenstand. In diesen Fällen spricht man von einem Sachkaufvertrag. Inhalt des
Kaufvertrages ist die Übertragung des Eigentums an der Sache sowie des Besitzes von dem
Verkäufer an den Käufer gegen Entgelt. Beispiel:
Käufer K erwirbt von Verkäufer V einen Drucker gegen Zahlung eines entsprechenden
Kaufpreises. Nach Übergabe und Übereignung der Sache (Drucker) ist K deren Eigentümer
geworden.
Gegenstand eines Kaufvertrages kann aber auch ein Recht, z.B. eine Kaufpreisforderung, sein.
Dann liegt ein Rechtskauf vor. Sehr oft ist dies der Fall, wenn Unternehmer ihre Außenstände
durch Verkauf der Forderungen an ein entsprechenden Inkassounternehmer hereinholen; man
spricht dann von Factoring. Beispiel:
Verkäufer V aus dem vorherigen Beispiel verkauft seine Kaufpreisforderung gegen den
säumigen Käufer K an das Inkasso- /Factoringunternehmen F. F zahlt an V einen - dem Risiko
der Einbringbarkeit der Forderung bei K entsprechend - niedrigeren Kaufpreis und macht die
alte Kaufpreisforderung gegen K in voller Höhe geltend.
Gegenstand von Kaufverträgen können aber auch immaterielle Güter, die weder Sache noch
Recht sind, sein. Hierzu zählen ganze Unternehmen, Know-How und sonstige, rechtlich nicht
geschützte Geheimnisse.
Bei einem Mietvertrag wird (zwingend) eine Sache vorübergehend überlassen. Der Jurist
spricht von der Übertragung des Besitzes, nicht jedoch des Eigentums, das beim Vermieter
verbleibt. Auch hier wird ein Entgelt geschuldet, das regelmäßig entsprechend der Dauer der
Überlassung bemessen wird. Beispiel:
Vermieter V vermietet an Mieter M den bereits bekannten Drucker für 2 Wochen gegen einen
täglichen Mietzins.
Der Pachtvertrag ist, ähnlich wie der Mietvertrag, auf die nur vorübergehende Überlassung
einer Sache gerichtet. Der Unterschied besteht darin, daß der Mieter die Mietsache nur
gebrauchen (benutzen) darf, der Pächter hingegen auch dazu berechtigt ist, die Nutzungen der
Sache zu ziehen (Fruchtgenuß). Beispiel:
Verpächter V verpachtet an Pächter P ein Feld mit Kirschbäumen. P darf diese Bäume nicht
nur benutzen - z.B. durch Besteigen -; P darf vielmehr auch die Kirschen ernten und
verkaufen.
Aus diesem Grund kann auch ein Recht Gegenstand eines Pachtvertrages sein, z.B. das
Jagdausübungsrecht bei der Jagdpacht. Gepachtet werden können aber - wie bei Kaufverträgen
- auch Unternehmen, z.B. Gastwirtschaften, Apotheken usw.
Inhalt eines Werkvertrages ist schließlich die entgeltliche Herstellung eines Werkes, das
sowohl körperlich (Sache) als auch nichtkörperlicher Art sein kann. Beispiel:
Besteller B beauftragt Werkunternehmener W mit der Herstellung des Druckers aus dem
vorherigen Beispiel.
Besteller B beauftragt Professor P mit der Erstellung eines Gutachtens.
Diesen im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelten Vertragstypen steht der gesetzlich nicht geregelte Lizenzvertrag gegenüber. Man begegnet diesem häufig im Bereich der gewerblichen Schutzrechte - Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Warenzeichen - sowie des Urheberrechts. Dem Lizenznehmer wird hierdurch gegen ein Entgelt - "Lizenzgebühr" - die Befugnis, nämlich das Recht, eingeräumt, das entsprechende Schutzrecht zu nutzen bzw. zu verwerten - "Lizenz". Diese Lizenz kann unterschiedlich ausgestaltet sein. So gibt es die ausschließliche (exklusive) Lizenz - einzig und allein dieser Lizenznehmer darf das betreffende Schutzrecht verwerten oder nutzen - wie auch die nicht ausschließliche (nichtexklusive) Lizenz, auch als einfache Lizenz bezeichnet. Die letztgenannte Formulierung findet man in fast jedem Software-Lizenzvertrag, da das Computerprogramm ja in der Regel nicht nur an einen Anwender verkauft und benutzt bzw. "lizenziert" werden soll. Auch die Entgeltsregelung ist variabel. So kann eine von der Benutzungs- oder Verwertungsdauer abhängige, aber ansonsten fixe, Lizenzgebühr vereinbart werden. Denkbar ist auch die Vereinbarung eines gewinnorientierten Entgelts, also einem Bruchteil des Verwertungserlöses. In den genannten Beispielen ist der Lizenzvertrag pachtähnlich ausgestaltet, da das zu lizenzierende Recht nicht dauerhaft und endgültig übertragen, sondern lediglich zur Verwertung überlassen wird. Soll das Schutz- bzw. Verwertungsrecht indes vollständig und dauerhaft übertragen werden, so wird man den betreffenden Lizenzvertrag den Regeln des Rechtskaufs unterstellen.
Der Lizenzvertrag hat also ein Recht zum Gegenstand. Allerdings muß es sich nicht um ein
gesetzlich geschütztes Recht, wie das Patentrecht, handeln. Es genügt vielmehr jedes
nichtkörperliche, geistige Gut, dessen Verwertung der Lizenzgeber dem Lizenznehmer
gestattet. In jedem Fall aber genügt nicht allein die Überlassung einer Sache, sei es mit, sei es
ohne Eigentumsübertragung, da dies entweder einen Kauf oder eine Vermietung darstellt.
Hier ist die Brücke zu den Computerprogrammen zu schlagen. Der eine oder andere Leser
wird sich an mehrere Beiträge in der c't erinnern, daß nach der mittlerweile überwiegenden
Auffassung in Rechtsprechung und Rechtswissenschaft Computerprogramme Sachen, also
körperliche Gegenstände, darstellen[1][2]. Wer sich
damit noch immer nicht anfreunden kann, der möge sich einmal vorstellen, was sein Computer ohne das
körperlich existierende Maschinenprogramm macht - nämlich nichts - und zu diesem Thema an
geeigneter Stelle nachlesen[3].
Wenn also Computerprogramme Sachen sind - was hindert eigentlich daran, denn dauerhaften
und entgeltlichen Erwerb eines solchen als Kauf einer Sache und dessen nur zeitweise
Überlassung als Miete einer Sache anzusehen? Die schlichte Antwort ist: Es gibt keinen
Hinderungsgrund. Wenn sich nämlich der Vertragsinhalt darin erschöpft und erschöpfen kann,
lediglich die Eigentumsübertragung an dem konkreten Programmexemplar oder die zeitweise
Überlassung des Besitzes zu regeln, so besteht weder Anlaß noch Rechtfertigung, von einem
Lizenzvertrag zu reden. Die in diesen Fällen zu erteilende Erlaubnis - "Lizenz" - bzw. das
einzuräumende Recht ist nichts anderes als der originäre Gegenstand des (Sach)Kaufvertrages
oder des Mietvertrages, nämlich die dauerhafte Übertragung des Eigentums bzw.
vorübergehende Überlassung des Besitzes an einer Sache.
Sachte, sachte, werden nun einige Leser sagen und darauf verweisen, daß Computerprogramme - wie man des öfteren lesen könne - urheberrechtlich geschützt seien. Dieser Einwand geht jedoch aus mehreren Gründen fehl. Zum einen ist bis zur Umsetzung der EG-Softwareschutz-Richtlinie schon nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nahezu kein Computerprogramm urheberrechtlich geschützt[4][5][6]. Zum anderen besagt allein die Urheberrechtsschutzfähigkeit nicht, daß bei Geschäften über die geschützten Gegenstände Lizenzverträge vorliegen müssen: So stellt der Erwerb eines zweifellos urheberrechtlich geschützten Druckwerkes - z.B. dieser Ausgabe der c't - nichts anderes als einen Sachkauf und nichts weniger als einen Lizenzvertrag dar. Gleiches gilt für den Erwerb einer Schallplatte bzw. CD - auch hier erschöpft sich der Inhalt des Vertrages in der Eigentumsübertragung gegen einmaliges Entgelt, so daß selbstverständlich "nur" ein normaler Sach-Kaufvertrag geschlossen wird. Dies geschieht überdies in fast allen Fällen noch nicht einmal ausdrücklich -
Käufer: "Ich biete Ihnen den Abschluß eines Kaufvertrags über diese Zeitschrift an, demzufolge Sie mir gegen Zahlung des Kaufpreises das Eigentum an dieser Zeitschrift übertragen und mir diese Zeitschrift übergeben."
Verkäufer: "Ich nehme Ihr Angebot an. Der Kaufpreis beträgt DM .... Hiermit übertrage ich Ihnen - Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises - das Eigentum an dieser Zeitschrift."- sondern konkludent, also stillschweigend, durch wortloses Hinlegen der Kaufsache an der Kasse und Bezahlen des Kaufpreises.
Aus dem Gesagten folgt nun zwingend, daß von einem Lizenzvertrag nur dann gesprochen
werden kann, wenn ein über den Inhalt des Kaufs oder der Miete bzw. Pacht hinausgehender
"Erfolg" gewollt ist. Dies wäre dann der Fall, wenn der Gebrauch bzw. die Benutzung eines
Computerprogramms eine Verwertung (Nutzung) darstellen würde, für die man eine
entsprechende Erlaubnis, nämlich die Lizenz, bedürfte.
In Betracht kommt hier zunächst das bereits erwähnte Urheberrecht. Ich möchte nicht jedoch
erneut die gesamte Problematik darstellen sondern verweise hier auf die bereits an anderer
Stelle erfolgten Ausführungen[6][3(Rdnr.479ff)].
Unterstellt, man hätte tatsächlich ein urheberrechtlich geschütztes Computerprogramm (oder
wir hätten bereits 1993 und eine Umsetzung der EG-Softwareschutz-Richtlinie), so wirft sich
die Frage auf, worin denn die Verwertungshandlung zu sehen ist, die dem Anwender erlaubt -
"lizenziert" - werden müßte und die den Überlassungsvertrag prägt. In der schlichten
Benutzung liegt diese Verwertungshandlung ganz sicher nicht - auch wenn dies von der
Softwareindustrie gerne behauptet wird. Auch ohne eine höchstrichterliche Entscheidung
kommt der gesunde Menschen- und Juristenverstand zu der Erkenntnis, daß die reine
Benutzung eines urheberrechtlich geschützten Werkes keine wie auch immer geartete
Werkverwertung sein kann. Andernfalls müßte auch das Lesen eines Buches, das Betrachten
eines Filmes oder das Anhören einer Schallplatte eines urheberrechtliche Verwertungshandlung
darstellen - die Absurdität dieser Vorstellung spricht für sich. Nachdem allerdings der
Bundesgerichtshof klargestellt hat, daß der Gebrauch eines Programm als solcher keine
Werkverwertung darstellt[5], kann man diese Behauptung schlicht vergessen.
Vertretbar ist lediglich, aus der allfälligen Notwendigkeit des Kopierens eines Programms bei
dessen Benutzung zu folgern, daß hierin urheberrechtlich relevante Verwertungshandlungen zu
sehen seien, die der Lizenzierung bedürften. Aber auch diese Argumentation führt nicht zum
Ziel: Nicht jede technische Duplizierung stellt eine urheberrechtliche relevante Vervielfältigung
dar. Das Kopieren des Programms von der Festplatte in den Hauptspeicher hat nämlich nicht
zur Folge, daß nun eine weitere Verwertungsmöglichkeit des Programms bestünde, also eine
weitere Kopie des Programms hergestellt werden würde[6][3(Rdnr.481ff)].
Das an dieser Stelle gerne auch von Vertretern der Softwareindustrie herangezogene Beispiel des Bösewichts, der
mit einer Programmdiskette eine Reihe von 100 PC abschreitet, bei jedem Rechner diese Diskette einlegt, das darin enthaltene Programm läd und zum Laufen bringt und die Diskette wieder entnimmt, ist offensichtlich völlig realitätsfremd. Sicherlich würde man in diesem Fall bei einem urheberrechtlich geschützten Programm von einer urheberrechtlich relevanten Verwertung durch Herstellung von Vervielfältigungsstücken sprechen können. Nur dürfte es
heutzutage kein des Kopierens wertes Programm geben, das auf diese Weise benutzt werden kann - abgesehen davon, daß dieses Beispiel eben nur eine Denkfigur darstellt und ohne praktische Bedeutung ist.
Es verbleibt somit in der Regel - und auf den Regelfall kommt es bei dieser typisierenden
Betrachtungsweise an - bei der Herstellung einer Arbeitskopie in der Festplatte. Darin ist bei
urheberrechtlich geschützten Programmen im Ergebnis zweifellos die Herstellung eines
Vervielfältigungsstücks zu sehen. Indes kann nicht gesagt werden, daß diese Handlung des
Inhalt des Vertrages prägt. Hauptzweck des Erwerbs des Programm ist offensichtlich nicht,
eine Arbeitskopie in der Festplatte herzustellen. Hauptzweck ist selbstverständlich, das
Programm zu benutzen. Die Herstellung einer Arbeitskopie ist lediglich eine technisch bedingte
Vorbereitungshandlung, die überdies noch nicht einmal wesenstypisch für die Benutzung eines
Computerprogramms ist: Vor noch nicht allzulanger Zeit war es absolut üblich, unmittelbar mit
den überlassenen Programmexemplaren zu arbeiten.
Es verbleibt somit zur Begründung eines Lizenzvertrages nur des Rückgriffs auf die
Überlassung eines nichtkörperlichen, geistigen Guts zur Nutzung. Nun könnte man trefflich
darüber streiten, ob man ein Computerprogramm als ein nichtkörperliches, geistiges Gut
angesehen werden kann. Da aber Computerprogramme in Form von ausführbaren Maschinen-
und Quellprogrammen Sachen darstellen, läßt sich die Annahme eines nichtkörperlichen,
geistigen Guts nicht rechtfertigen[1][2][3].
Vertreter dieser Auffassung stellen regelmäßig auf den zur Herstellung eines Programms erforderlichen,
geistigen Entwicklungsaufwand ab. Mit eben diesem Argument kann aber auch der Hersteller eines Atomkraftwerkes
behaupten, daß dieses ein unkörperliches, geistiges Gut darstelle. Der entscheidende Denkfehler wird -
vielleicht sogar bewußt - darin begangen, daß nicht auf das konkrete Programmexemplar,
sondern eben die Entwicklungsleistung als geistiges Werk abgestellt wird. Diese wird jedoch
gerade nicht übertragen - die Softwarehersteller bemühen sich sogar intensiv, den Anwender
von tieferen Einblicken in das Programm sowie Kenntnisnahme von dem Know-how
fernzuhalten.
Aus dem zuletzt genannten Grund kann man sich auch nicht in die Annahme eines Know-how-
Lizenzvertrages retten, wie dies von einem großen EDV-Hersteller ständig versucht wird. Man
möge mir nur einen Software-Überlassungvertrag zeigen, in dem dem Anwender das
Programm(ier)-Know-how überlassen wird - gerade das Gegenteil ist, wie erwähnt, der Fall.
Daß aber allein die Überlassung eines lediglich mit Know-how hergestellten Produkts nicht
genügt, um von einer Know-how- Überlassung auf lizenzvertraglicher Grundlage zu sprechen,
dürfte auch ohne weitere Begründung unmittelbar einleuchten - andernfalls wäre auch der Kauf
eines Synthesizers oder einer Digitaluhr ein Know-how-Erwerb.
Schließlich geht auch die oft verwendete Formulierung der "Lizenzierung" eines
"Gebrauchsrechts" ins Leere, denn dieses stellte nichts anders als die Überlassung der Sache
zur Benutzung, also Besitzüberlassung, dar, die entweder als Miete bzw. Leasing oder Kauf
einzuordnen wäre.
Beschränkt man sich auf die mit den Anwendern/Endverbrauchern abgeschlossenen Verträge, so ist also festzustellen, daß deren Bezeichnung als "Lizenzvertrag" sowie die darin enthaltene "Lizenzierung" irgendeinen Rechts - zumindest als Hauptgegenstand des Vertrags - schlichtweg unzutreffend ist. Eine andere Beurteilung ist freilich bei Vertriebsverträgen zwischen z.B. Hersteller und Distributor/Importeur geboten. Dies ist allerdings nicht software- spezifisch, sondern gilt für alle Arten von Vertriebsverträgen bzw. Waren.
Wenn es sich also bei dem Erwerb von Computerprogrammen regelmäßig "nur" um einen
schlichten Kaufvertrag (über eine körperliche Sache) handelt - in den seltensten Fällen liegt ein
Mietvertrag vor, öfters schon ein Leasingvertrag -, warum - so werden Sie sich bzw. mich zu
Recht fragen - wird dann von der Softwareindustrie nach wie vor von Lizenzverträgen
geredet?
Diese hat mehrere Gründe. Zunächst ist zu erkennen, daß die ersten
Softwareüberlassungsverträge aus den USA kamen und unreflektiert, d.h. ohne
Berücksichtigung der deutschen Rechtsordnung, einfach nur übersetzt wurden. Außerdem
kommen auch heute noch sehr viele dieser Verträge von US-amerikanischen Firmen, die beim
Vertrieb ihrer Programme auch in Deutschland nicht von ihren in den USA bewährten
Verträgen lassen möchten. Ein weiterer Grund ist, daß bislang Umfang und Möglichkeiten des
Urheberrechtsschutzes von Computerprogrammen recht unklar war und - nach meiner
Auffassung - weit überschätzt wurde. Hinzu kommt, daß vielerorts bis heute einfach verkannt
wird (oder verkannt werden will), daß die schlichte Benutzung eines Computerprogramms
etwas anderes ist als dessen Verwertung - hier besteht, wie oben dargelegt, kein Unterschied zu
einem beliebigen anderen Gegenstand. Schließlich darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß die
Behauptung eines gesetzlich nicht geregelten Lizenzvertrages als Softwareüberlassungsvertrag
dem Lieferanten zumindest theoretisch die Möglichkeit bietet, allerlei Haftungs- und
Gewährleistungsausschlüsse sowie sonstige einseitige und unbillige Verpflichtungen des
Anwenders in das umfangreiche Vertragswerk hineinzuschreiben, ohne daß diese Regelungen
offensichtlich an dem Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen scheiterten. Anwender,
die ihre Programme mittels eines solchen Lizenzvertrages erworben haben, können sich jedoch
damit trösten, daß die Rechtsprechung mittlerweile nahezu jeden dieser Verträge als einen
(Sach-)Kaufvertrag behandelt, so daß sich die Zulässigkeit deren "Kleingedrucktes" an dem
Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen orientiert. Dennoch sollte man vorsorglich und
nach Möglichkeit die Unterzeichnung eines solchen Vertrages vermeiden.
Literatur/Rechtsprechungsnachweise:
[1] Dr. M. Michael König, Sachlich sehen, c't 3/91, S.70ff
[2] Dr. M. Michael König, Geliebtes Deutsch, c't 2/92, S.54ff
[3] Dr. M. Michael König, Das Computerprogramm im Recht, 1991, Rdnr.254ff, 601ff
[4] Bundesgerichtshof, Urteil "Inkasso-Programm" vom 9.5.1985, Aktenzeichen I ZR 52/83,
nachzulesen in NJW 1986, S.192
[5] Bundesgerichtshof, Urteil "Betriebssystem" vom 4.10.1990, Aktenzeichen I ZR 139/89,
nachzulesen in jur-PC 1/91, S.888
[6] Dr. M. Michael König, Programm für ROM und RAM, c't 3/92, S.68ff